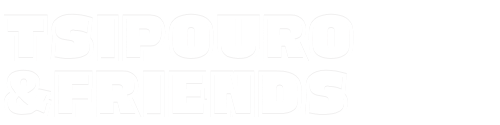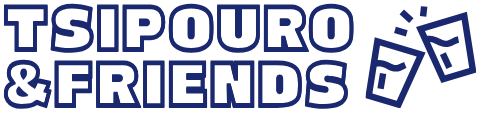Tsipouro – kleiner Schluck, große Kultur
Tsipouro ist ein klarer Tresterbrand aus Griechenland. Er entsteht aus dem Trester der Weinbereitung – also Schalen, Kernen und restlichem Fruchtfleisch – und wird traditionell in Kupferbrennblasen destilliert. Im Glas hat er meist 40% bis 45% Alkohol und zeigt zwei Grundstile: ohne Anis wirkt er pur, traubig und trocken; mit Anis bringt er eine feine Kräuternote mit, die sich mit Wasser oder Eis milchig trübt – ein natürlicher Effekt der ätherischen Öle.

Ein kurzer Blick in die Geschichte
Die Wurzeln führen bis ins späte Mittelalter. Aus klösterlichen Brenntraditionen entwickelte sich im Lauf der Jahrhunderte ein Volksgetränk, das vor allem in Thessalien (mit der Hafenstadt Volos) und in Makedonien ein festes Zuhause fand. Parallel gibt es auf Kreta den eng verwandten Tresterbrand Tsikoudia (auch Raki), der in der Regel ohne Anis daherkommt. Heute findest du Tsipouro von kleinen Familienbrennereien bis zu etablierten Herstellern – von ganz klar bis selten sogar fassgereift.
Wie Tsipouro entsteht – Schritt für Schritt
Fermentation des Tresters
Nach dem Pressen wird der Trester vergoren. Rebsorte, Sauberkeit und Gärführung bestimmen später Duft und Mundgefühl.
Destillation in Kupfer
Die Brenner trennen Vorlauf, Herzstück und Nachlauf. Das saubere Herz wird gesammelt; je nach Stil wird ein- oder zweimal gebrannt.
Mit oder ohne Anis
Für die Anisvariante werden Anissamen (und teils Fenchel oder Kräuter) mazeriert oder mitdestilliert. Die ätherischen Öle sorgen für die typische Aniswürze und den milchigen Schimmer bei Wasser/Eis.
Ruhen, Mischen, Abfüllen
Nach dem Verdünnen auf Trinkstärke ruht der Brand, wird ggf. filtriert und abgefüllt. Seltene Spezialitäten reifen kurz im Holz.
Tsipourádiko – so funktioniert die Taverne
Der vielleicht schönste Teil der Kultur: Man bestellt keinen Teller, sondern eine kleine 50ml Flasche Tsipouro. Die Meze-Teller kommen dazu. Was genau auf den Tisch kommt, entscheidet die Küche. Alles steht in der Mitte, alles wird geteilt. Jede Runde bringt andere Kleinigkeiten, oft zuerst salzig-frisch, später warm und herzhaft. So entsteht ein langsamer Rhythmus: ein Schluck, ein Happen, ein Gespräch.
In klassischen Tsipourádika steht Fleisch nicht auf der Karte. Stattdessen dominieren Meeresfrüchte und Fisch – von Sardellen, Sardinen und Garnelen über Oktopus bis Kalmar – ergänzt um Gemüse, Käse und Dips wie Skordalia oder Tzatziki.
Typische Missverständnisse – kurz erklärt
Tsipouro ist nicht Ouzo. Ouzo basiert auf neutralem Alkohol mit Anis und Kräutern; Tsipouro ist ein Tresterbrand – näher an Grappa, jedoch mit eigenem Stil und regionalen Prägungen.
Fleisch fehlt nicht „aus Versehen“. Es ist Teil der Tradition, dass die Meze ohne Fleisch auskommen. Im Hafen entstand diese Küche aus dem, was man frisch hatte: aus dem Meer, dazu Gemüse und Käse.
Milchig heißt nicht „kaputt“. Das Trübwerden der Anisvariante mit Wasser oder Eis ist normal und nennt sich Louche-Effekt.
Tsipouro ist mehr als ein Destillat. Es ist Ritual, Rhythmus und Gesprächskultur. Man bestellt einen Schluck und bekommt eine kleine Welt auf Tellern dazu. Fisch statt Fleisch, teilen statt besitzen, langsam statt schnell – so entsteht ein Abend, der bleibt.